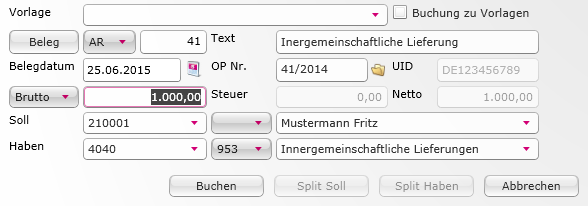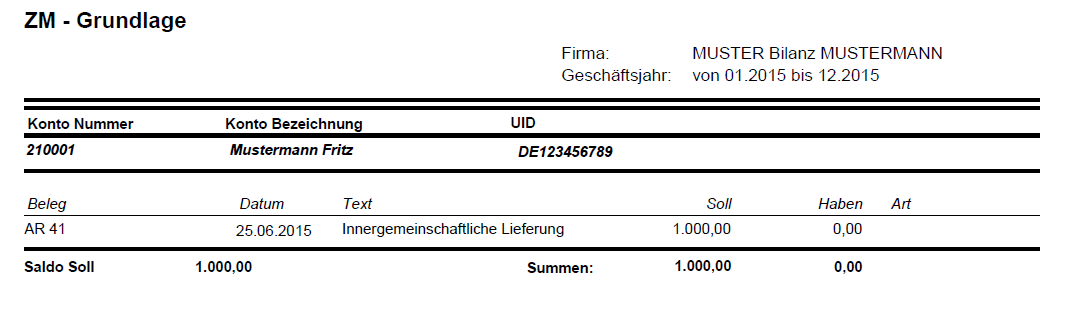Gastbeitrag von Mag. (FH) Andreas Chrastka, stellvertretender Geschäftsführer von i2b – ideas to business
Der Businessplan muss sich aktuell viele Vorwürfe gefallen lassen. Das Portfolio reicht von „nicht mehr zeitgemäß“ bis hin zu „schädlich für die weitere Entwicklung des Unternehmens“. Dass diese Wortmeldungen aus vielen verschiedenen Richtungen kommen, legt die Vermutung nahe, dass sie ihre Berechtigung haben könnten. Höchste Zeit also, das Thema Businessplan einmal genauer zu beleuchten und Ihnen alternative Möglichkeiten aufzuzeigen.
Beginnen wir unsere Analyse beim Wort selbst. Die einfachste Erklärung oder Umschreibung dafür wäre: „Ein Plan, der beschreibt, wie wir eine neue Unternehmung aufbauen möchten.“ Das klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär, gleichzeitig aber auch nicht wirklich umständlich oder abnormal. Der Grund dafür könnte ein ganz einfacher sein: Der Mensch ist ein Planungstier!
Planung ist das halbe Leben
Denken Sie nur einmal an Urlaube. Hier beginnt die Planung oft schon mit dem zu wählenden Zeitpunkt. Da werden die Urlaubstage mit den KollegInnen im Büro abgestimmt eventuell auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten oder dem Partner. Anschließend werden Angebote durchforstet, Überlegungen angestellt, was man sehen möchte, welche Art Urlaub es überhaupt werden soll, welches Ziel man ansteuert. Pläne werden geschrieben, wieder verworfen, neu geschrieben, Budgets abgeglichen oder herumgeschoben – wie oft haben meine Eltern schon die neue Küche verschoben, weil sie doch noch einmal wohin fliegen wollten. Besagte Küche feierte kürzlich übrigens ihren 25er!
Natürlich ist eine gewisse Flexibilität bei Urlauben gerne gesehen und wird auch speziell bei der jüngeren Generation immer beliebter. Aus meiner Erfahrung schlägt sich das aber eher in der freien Wahl der Reiseroute mittels Mietauto nieder, als in einem komplett planlosen Abenteuerurlaub – und selbst beim Backpacking werden mittlerweile die Unterkünfte zumindest teilweise vorab im Internet gebucht. Reisen, die unter dem Motto „der Weg ist das Ziel“ stehen, werden vermutlich auch in absehbarer Zukunft eher ein Nischenprodukt bleiben.
Ich bin dann mal weg
Sie sind noch nicht überzeugt? Vielleicht nehmen Sie sich tatsächlich öfter mal kurzfristig frei, setzen sich ins Auto oder aufs Motorrad und klinken sich einfach mal für ein paar Tage aus? Zuerst einmal: Gratulation – irgendwann will ich das auch noch machen. Einfach zum Flughafen fahren und sehen, wann der nächste Flieger in die Karibik geht. Aber, ich gebe mich noch nicht geschlagen, zumindest was das Planungsthema angeht.
Planung im Alltag
Es existieren diverse Testberichte von Smartphone-Apps für Shopping-Listen – zum Beispiel die Top 10 der besten Einkaufslisten-Apps für iOS and Android – zusätzlich zu den Lösungen, die bereits ab Werk vorhanden sind. Eine Einkaufsliste ist aber nicht nur eine Gedankenstütze, sie ist auch ein Teilbereich eines Plans – denn um zu wissen, was man braucht, muss man auch wissen, was man damit vor hat. Wer also mit dem Gedanken spielt Freunde, Bekannte oder Verwandte zum Essen einzuladen, wird üblicherweise gewisse Grundüberlegungen anstellen. Ob das nun nach dem „ich ruf wen an, der sich damit auskennt“-Prinzip abläuft, oder ob man sich doch selbst in den Kampf stürzt und recherchiert – am Ende steht immer ein mehr oder weniger umfangreicher Plan. Was gibt es zu essen, wer macht es, wo wird es gemacht und was brauche ich dafür – eventuell noch mit einem kleinen Zeitplan dazu, schließlich ist nichts blöder, als wenn die Beilagen zum bereits fertigen Braten noch halb roh sind.
Es gibt noch unglaublich viele andere Situationen die aufzeigen, dass wir in unserem Leben und unserem Alltag viel mehr planen, als uns eigentlich bewusst ist, aber mit deren Aufzählung wäre es mir ein leichtes, den Rahmen dieses Mediums sprengen. Sie sind aber natürlich gerne eingeladen, selbst ein bisschen darüber zu sinnieren und sich zu fragen, wann Sie zuletzt etwas geplant haben, auch wenn Sie es vielleicht gar nicht als Planung empfunden haben.
Was will ich Ihnen damit sagen?
Vielleicht fragen Sie sich aber auch nur, was dieses kleine Gedankenexperiment jetzt eigentlich mit dem Thema Businessplan zu tun hat. Nun, die Sache ist die: Menschen neigen dazu, für vergleichsweise weniger relevante Dinge einen größeren Aufwand auf sich zu nehmen, während sie bei augenscheinlich relevanteren Bereichen vor gewissen Aufwendungen zurückscheuen. So kommt es dann zum paradox erscheinenden Umstand, dass Personen sich zwar monatelang mit der Planung eines zweiwöchigen Urlaubs an der Côte d’Azur beschäftigen, gleichzeitig aber die schriftliche Planung ihrer Zukunft in Form eines eigenen Unternehmens, in welches sie üblicherweise viel Zeit und Geld investieren, als Zeitverschwendung ansehen.
Wir haben doch keine Zeit!
Der Faktor Zeit scheint jedoch generell ein beliebtes Argument gegen den Businessplan zu sein. So erzählte mir unlängst ein Unternehmensberater, der sich auf den Lean Startup Ansatz spezialisiert hatte, dass es doch ein vollkommener Blödsinn sei, sich monatelang mit den Einzelheiten eines Businessplans auseinanderzusetzen, ohne zu wissen, ob die Produktidee überhaupt Erfolg haben könnte. Da hat er absolut Recht! Ich bin mir nur nicht so sicher, ob es sich dabei um einen Fehler im Konzept des Businessplans handelt.
Im Gespräch mit BeraterInnen und GründerInnen höre ich immer wieder, dass die Leute sich gerne auf das konzentrieren, was sie entweder gut können und was ihnen Spaß macht. Für diese Erkenntnis müsste ich eigentlich gar nicht lange suchen – ist ja bei mir genauso und auch immer schon so gewesen. Wenn im Studium oder während der Schulzeit eine Präsentation vorzubereiten war, habe ich mich zuerst einmal stundenlang mit dem Design auseinandergesetzt: Farben, Formen, Schriftarten, eventuell ein eigenes Logo. In den sprichwörtlich letzten 5 Minuten vor 12 kamen dann die ungeliebten Inhalte dran. Das ist halt so und so mancher wird sowas auch schon einmal erlebt haben. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass dieses Verhalten nicht sonderlich effizient ist.
Was allerdings im Studium im schlimmsten Fall zu einer schlaflosen Nacht geführt hat, kann später mitunter richtig teuer werden. Dann nämlich, wenn man bereits ein Logo entwerfen hat lassen, das bereits auf der eigens erstellten Website platziert ist und man dann bemerkt, dass das Geschäftskonzept so gar nicht funktionieren kann.
Das Pferd von hinten aufzäumen
Es ist also definitiv ratsam, einige Kenngrößen abzuklären, bevor man sich voller Tatendrang der Vermarktung eines ungetesteten Produkts zuwendet. Trotz aller „Ja, eh klar“-Momente handelt es sich hierbei dennoch um einen durchaus ernstzunehmenden Kritikpunkt: Die Reihenfolge der Kapitel im Businessplan muss nicht automatisch der Reihenfolge der Erstellung ebendieser entsprechen. Vielmehr wäre eigentlich zu einem gesunden Chaos zu raten, sind doch viele der Inhalte voneinander abhängig. Dabei kann es durchaus hilfreich sein, sich einiger neuerer Methoden zu bedienen.
Planung mal anders
In diesem Zusammenhang wird gerne der Business Model Canvas nach Alexander Osterwalder genannt. Die Grundidee ist ebenso simpel wie genial: Das geplante Geschäftsmodell wird in 9 Segmente unterteilt, von der Kostenstruktur, über die Umsätze bis hin zu Kunden und Schlüsselpartnern. Praktischerweise lässt sich der Canvas auf einem großen Blatt Papier ausdrucken (oder auf eine Tafel oder Wand zeichnen) und die einzelnen Inhalte werden stichwortartig per Post-it in den jeweiligen Segmenten platziert. Das geht schnell und das Modell lässt sich unkompliziert und ohne viel Aufwand wieder verändern, sollte sich einem eine gewisse Diskrepanz eröffnen – ein Post-it ist einfach schneller geschrieben als zwei bis drei A4-Seiten.
Diese Einfachheit machte den Business Model Canvas zu einem wichtigen Werkzeug der Lean Startup Philosophie. Doch weshalb eigentlich nur dort? Der BMC ist nämlich auch perfekt als Vorstufe für den Businessplan einsetzbar – eben genau um das Geschäftsmodell zu skizzieren und etwaige Probleme zu erkennen, bevor man schon zu tief drinnen steckt um noch einmal alles über den Haufen zu werfen.
Übrigens, auch der Canvas hat sich seit seiner Einführung 2008 weiterentwickelt. Diverse Tools, die mittlerweile für Browser, Tablet und Smartphone angeboten werden, haben auf die Limitierung durch Post-its reagiert: Zu jedem Post-it gibt es eine eigene Notizen-Sektion, in der man das Schlagwort mit ausformulierten Erklärungen und Hintergrundinformationen ausstatten kann – die genaue Bedeutung von Schlagwörtern kann nämlich – so hat man festgestellt – für Außenstehende manchmal schwer nachvollziehbar sein. Genau genommen war ich mir auch schon selbst beim Lesen einer mehrere Wochen alten Notiz das ein oder andere Mal unsicher, was ich damit denn nun gemeint hätte. Der langen Rede kurzer Sinn: die Hintergrundinfos zu den Schlagwörtern kann man dann zwecks Erklärung einfach an den Canvas anhängen.
Ausprobieren, nachfragen, anpassen
Der Business Model Canvas alleine ist übrigens leider kein Garant dafür, dass das Geschäftsmodell auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Der Vorteil liegt eher darin, dass man sich einmal Gedanken darüber macht, wie das Geschäftsmodell überhaupt aussehen könnte – um irgendeine Art von Test kommt man aber dennoch nicht herum, wenn man sein Vermögen nicht etwa gerade beim Glücksspiel gewonnen hat und den Schritt in die Selbstständigkeit als neues Casinospiel ansieht.
Abhängig von Produkt- bzw. Geschäftsidee, dem geplanten Modell der Umsatzgenerierung und der Zielgruppe, gibt es dafür unterschiedliche Möglichkeiten, wie etwa Mini-Markttests mit Prototypen oder 0-Serien, Umfragen (persönlich oder Online) oder zum Beispiel Verkostungen auf Messen. Am Ende läuft es aber immer darauf hinaus, Kontakt zur potentiellen Zielgruppe aufzunehmen und die Strategie entsprechend der Ergebnisse anzupassen.
Sie sind nicht allein
Wie viele andere Dinge, müssen Sie auch diese Tests nicht alleine durchführen. Unterstützung gibt es etwa in Form von Unternehmensberatungen, die sich des Themas annehmen, in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die geeigneten Tests durchführen und einen bereits ausformulierten Abschlussbericht mit Vorschlägen für die weitere Vorgehensweise (Vermarktung, Verkauf, Umsetzung) anfertigen. Tipp: Dieser Bericht eignet sich ebenfalls hervorragend als Basis für die entsprechenden Kapitel im Businessplan.
Würde man theoretisch die Hintergrundinformationen und Notizen des Business Model Canvas mit den Ergebnissen des Markttests kombinieren, eine ausführliche Beschreibung der Geschäftsidee voranstellen und die Lebensläufe des Gründerteams anhängen, so hätte man bereits den Großteil eines typischen Businessplans beisammen – inklusive wichtiger Eckdaten der oft so verhassten Finanzplanung.
Über den Autor
![Der Businessplan Überbleibsel der Vergangenheit oder modernes Werkzeug? Der Businessplan Überbleibsel der Vergangenheit oder modernes Werkzeug?]()
|
|
Mag. (FH) Andreas Chrastka ist stellvertretender Geschäftsführer von i2b – ideas to business.
i2b unterstützt GründerInnen gemeinsam mit einem Netzwerk von mehr als 200 ExpertInnen, Partnern und Sponsoren aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor bei der Erstellung von Businessplänen zur Vermarktung von innovativen Produkt- und Dienstleistungsideen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Das jährliche Highlight ist der österreichweite i2b Businessplan-Wettbewerb, im Zuge dessen herausragende Businesspläne prämiert werden.
|
The post Der Businessplan – Überbleibsel der Vergangenheit oder modernes Werkzeug? appeared first on ProSaldo.net.